? Deine perfekten Texte + Roter Faden
Mehr erfahrenKommentar
Weitere Themen
- Anleitungen + Beispiele
- Bachelorarbeit
- Masterarbeit
- Dissertation
- Hausarbeit
- Seminararbeit
- Studienarbeit
- Praktikumsbericht
- Facharbeit
- Essay
- Report (Bericht)
- Kommentar
- Gutachten
- Hilfe für Akademiker
- Schneller Lernen
- Studium Klausuren
- Wissenschaftliches Schreiben
- Wissenschaftliches Poster
- Abbildungen & Tabellen
- Methodik
- Richtig Zitieren
- Plagiate vermeiden
- Richtig Zitieren
- APA 6 und 7
- Harvard zitieren
- IEEE zitieren
- Lexikon
- Experten-Ratgeber (Gratis E-Books)
- Begriffe Studium A – Z
- Geschäftsunterlagen nach DIN
- Groß- und Kleinschreibung
- Experten helfen dir 🎓
- Bücher + Kurse
- Thesis-Start-Coaching
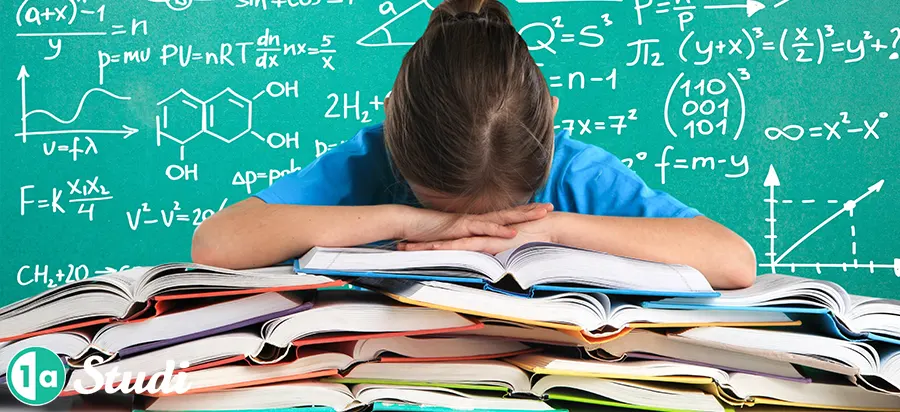
Materialgestütztes schreiben Kommentar
Eine Aufgabe im Abitur oder im Studium ist das materialgestützte Schreiben eines Kommentars. Hierfür verfasst du Argumente zu einem Thema und gibst deine Meinung wieder.
Hierfür benötigst du Analysefähigkeiten und eine klare Struktur.
In diesem 1a-Studi Artikel lernst du, wie dir das Kommentar schreiben anhand von Materialien einfach mithilfe von Vorlagen gelingt.
Inhaltsverzeichnis
Kommentar materialgestütztes Schreiben
Das Kommentar materialgestützte Schreiben basiert auf mehreren Daten. Hierzu bekommst du in der Regel ein Dossier zur Verfügung gestellt oder musst diese erst selbst recherchieren.
Materialien für einen Kommentar:
- Artikel und Aufsätze (wissenschaftliche Artikel, Meinungsaufsätze, Zeitungsartikel)
- Statistiken und Diagramme
- Berichte und Studien
- Buchauszüge
- Zitate: Aussagen von Experten, Persönlichkeiten
- Gesetze und Verordnungen
Der Umfang eines materialgestützten Kommentars beträgt in der Regel zwischen 1000 und 1500 Wörtern und besteht aus den Teilen:
- Einleitung
- Hauptteil
- Schluss
In der Einleitung eines Kommentars wird ein interessanter Einstieg formuliert sowie das Thema begründet und eine These aufgestellt. Dieser wird im Hauptteil nachgegangen. In diesem werden die Argumente und Gegenargumente präsentiert. Der Schlussteil dient dazu, die These anhand der wichtigsten Fakten zu beantworten und den Lesern zum Nachdenken anzuregen.
Lernziel: Verstehen, dass das materialgestützte Verfassen eines argumentierenden Texts im Abitur ein wichtiger Bestandteil ist und kritische Analysefähigkeiten sowie die Fähigkeit, eigene Standpunkte zu artikulieren, erfordert.
Wissenschaftliches Lektorat
Die 1a-Studi Fach-Lektoren finden im Durchschnitt 2000 Fehler 🎓 Interessiert an einer Eins Komma im Studium?
Zu deiner Korrektur und Prüfung
Materialgestütztes Schreiben Kommentar Beispiel
Beim Kommentieren beziehst du dich auf ein bestimmtes Ereignis oder Zeitproblem. Hierbei nimmst du eine eigene Position ein und begründest diese mit belegten Argumenten.
Deine eigene Meinung ist ebenfalls gefragt. Ein Kommentar ist somit geprägt durch dein Meinungsbild und soll zu neuen Ansichten beitragen.
Um die Fakten und deine Meinung anschaulich zu formulieren, braucht dein Kommentar eine klare Struktur. Die folgenden Beispiele für ein materialgestützten Kommentar zeigen dir 3 Varianten, die sich einfach umsetzen lassen:
- Standardschema
- Themen-/Thesenbezogen
- Argumentationsbezogen
Das Standardschema findet sich ebenfalls in Essays und Seminararbeit wieder.
Einleitung
- Interessanter Einstieg
- Darstellung des Themas
- Aufstellen einer These
Hauptteil
- Argumentation (pro und contra)
Schluss
- Fazit und Ausblick
Lerntechniken der 1.0er-Studenten lernen
Durch die speziellen Lerntechniken und Lernmethoden der Erfolgsstudenten wirst du deine Lernziele leichter erreichen. ?
Jetzt "Studieren mit Strategie" anschauen
Themen-/Thesenbezogen Kommentar
Indem du die These zu Beginn als Einstieg formulierst, setzt du einen starken Impuls. Die Meinung des Lesers wird hierbei bereits beeinflusst. Dies kann dazu führen, dass der Leser verstärkt Interesse durch Zusage oder Ablehnung deiner These erlangt und dadurch deinen Kommentar lesen will.
Einleitung
- These (nach einer sehr kurzen allgemeinen Einleitung)
- Erklärung des Themas
Hauptteil
- Argumentation (pro und contra)
Schluss
- Fazit und Ausblick
Argumentationsbezogen Kommentar
Ähnlich wie bei der These zu Beginn kannst du auch mit den wichtigsten Argumenten oder Gegenargumenten beginnen. Diese steuert ebenfalls die Meinung des Lesers und kann zur Zustimmung und Ablehnung führen. Dies macht deinen Kommentar interessant.
Einleitung
- Argumentation (pro oder contra nach kurzer allgemeiner Einleitung)
- Erklärung des Themas
- These
Hauptteil
- Ergänzung der Argumente oder Gegenargumenten
Schluss
- Fazit und Ausblick
Lernziel: Wissen, dass diese Form des Schreibens mehrere spezifische Merkmale hat, darunter das Arbeiten mit einem Dossier, das Berücksichtigen aller Materialien, das Einbringen eigenen Wissens und das Verfassen des Texts in einer bestimmten Rolle.
6 Schritte-AnleitungMaterialgestützter Kommentar
Anhand der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du deinen materialgestützten Kommentar sicher schreiben:
Schritt 1: Aufgabenstellung analysieren
Zuerst stellst du sicher, dass du die Aufgabenstellung vollständig verstehst. Achte auf die spezifischen Anforderungen, wie die Textsorte, die vorgegebene Funktion des Textes oder die Zielgruppe.
Schritt 2: Materialien durchlesen und analysieren
Beginne mit einer genauen Durchsicht aller Materialien. Notiere dir sich während des Lesens die Schlüsselinformationen, Argumente und Positionen, die im Kommentar behandelt werden könnten. Verstehe die Hauptargumente und den Kontext jedes Dokuments.
Express-Notfall-Hilfe
Hilfe im Notfall: 48, 24, 12 Stunden. Am Wochenende und Feiertag ⚡
- Alle Korrekturdienste verfügbar
- Bachelorarbeit
- Masterarbeit
- Hausarbeit

Schritt 3: Themen und Argumente identifizieren
Basierend auf deiner Analyse der Materialien, identifizierst du die zentralen Themen und die damit verbundenen Argumente. Versuche, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Materialien zu erkennen. Mache dir viele Notizen.
Schritt 4: Deinen Standpunkt festlegen
Lege deine Position im Kommentar fest. Dein Standpunkt sollte sich auf die identifizierten Themen und Argumente stützen und kann von den bereitgestellten Materialien unterstützt oder widerlegt werden.
Schritt 5: Kommentar schreiben
Als nächstes schreibst du deinen Kommentar mit der Struktur: Einleitung, Hauptteil, Fazit. Achte darauf, sowohl Informationen aus den Materialien als auch eigenes Wissen einzubringen.
Schritt 6: Überarbeitung und Korrektur
Überprüfe deinen Kommentar auf Vollständigkeit, Klarheit und Struktur. Stelle sicher, dass alle Teile (Einführung, Darstellung des Themas, These, Argumentationsteil, Fazit und Ausblick) vorhanden und in einer logischen Reihenfolge angeordnet sind.
Studi-Tipp: 1a-Studi hilft dir bei der Korrektur aller grammatikalischer oder stilistischer Fehler .
BeispielMaterialgestütztes Schreiben argumentierender Texte Beispiel
Angenommen, du bekommst ein Dossier zum Thema Digitalisierung in Unternehmen mit verschiedenen Materialien: Statistiken, wissenschaftliche Artikel und Berichte. Deine Aufgabe ist es, einen Kommentar zu verfassen, der auf diese Materialien Bezug nimmt und gleichzeitig deine eigene Meinung und Wissen einbringt.
In der Einleitung leitest du in das Thema ein und weißt auf die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung in Unternehmen hin. Hierfür kannst du Zitate oder Informationen aus den Materialien verwenden.
Anschließend stellst du eine These auf, die deine eigene Meinung zum Ausdruck bringt.
Ich bin der Meinung, dass Unternehmen von der Digitalisierung profitieren und daher aktiv investieren sollten.
Im Argumentationsteil belegst du dann deine These mit Argumenten aus den Materialien, aber auch eigenen Gedanken und Ideen.
Fasse im Schlussteil die wichtigsten Ergebnisse zusammen und schließe deinen Kommentar mit den einem Ausblick sowie Abschlussappell (Handlungsaufforderung).
Lernziel: Anhand eines Beispiels verstehen, wie ein materialgestützter Kommentar aussehen könnte. Sie sollten in der Lage sein, ein Dossier zum Thema Klimawandel zu analysieren und daraus einen Kommentar zu verfassen, der sowohl auf die Materialien Bezug nimmt als auch eigene Meinungen und Wissen einbringt.
Studiere dich schlau

