? Deine perfekte Abschlussarbeit
Studenten-Rabatt sichernWissenschaftliches Arbeiten
Weitere Themen
- Anleitungen + Beispiele
- Bachelorarbeit
- Masterarbeit
- Dissertation
- Hausarbeit
- Seminararbeit
- Studienarbeit
- Praktikumsbericht
- Facharbeit
- Essay
- Report (Bericht)
- Kommentar
- Gutachten
- Hilfe für Akademiker
- Schneller Lernen
- Studium Klausuren
- Wissenschaftliches Schreiben
- Wissenschaftliches Poster
- Abbildungen & Tabellen
- Methodik
- Richtig Zitieren
- Plagiate vermeiden
- Richtig Zitieren
- APA 6 und 7
- Harvard zitieren
- IEEE zitieren
- Lexikon
- Experten-Ratgeber (Gratis E-Books)
- Begriffe Studium A – Z
- Geschäftsunterlagen nach DIN
- Groß- und Kleinschreibung
- Experten helfen dir 🎓
- Bücher + Kurse
- Thesis-Start-Coaching

Wissenschaftliche Arbeit schreiben
Eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, trifft auf Studierende im Bachelor- und Masterstudium zu. Aber auch im Gymnasium werden Facharbeiten geschrieben. Hierbei handelt es sich um kleine wissenschaftliche Arbeiten.
Das Ziel einer wissenschaftlichen Arbeit ist es, ein spezifisches Thema anhand einer Fragestellung/Zielsetzung unter Anwendung einer wissenschaftlichen Methodik zu bearbeiten.
Dabei verfolgt dein wissenschaftlicher Text einen roten Faden.
Das wissenschaftliche Arbeit schreiben ist eine eigene Fachdisziplin und erfordert sehr viel Struktur und logisches Textverständnis.
In diesem 1a-Studi Artikel lernst du, wie dir das wissenschaftliche Arbeiten gelingt und was du beim wissenschaftlichen Schreiben beachten solltest.
Inhaltsverzeichnis
Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Word
Das wissenschaftliche Arbeit schreiben mit Word ist ideal für deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit.
Die Funktionen von Word sind zwar teilweise komplex – hierbei hilft dir 1a-Studi mit der 100%igen Formatierung nach den Richtlinien –, jedoch für das Gliedern und Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit sehr einfach zu bedienen.
Für das wissenschaftliche Arbeit schreiben bietet dir Word:
- Überschriften und Gliederung
- Abbildungs- und Tabellenfunktionen
- Automatische Verzeichnisse
- Zitationsverwaltung und Fußnotenbereich
- Querverweise
- Formatierung von Schriften und Farben
Damit dir das Schreiben deiner wissenschaftlichen Arbeit einfach gelingt, findest du bei 1a-Studi Vorlagen für deine Abschlussarbeit. Du musst dich nicht mit den komplizierten Einstellungen beschäftigen, sondern kannst sofort mit dem Schreiben in Word loslegen.
1a-Studi-Tipp: Prüfe, ob deine Hochschule dir eine Vorlage bereitstellt. Diese solltest du dann unbedingt nutzen. Die Formatierung (wichtiger Bewertungsteil) übernimmt 1a-Studi für dich.
16 professionelle Korrekturdienste 🎓
Garantiert Studium mit sehr guter Note bestehen! Lass dir jetzt vom Testsieger für wissenschaftliche Lektorate bei deinem Bachelor und Master helfen.
- 3 Textkorrekturstufen
- Zitation & Literaturverzeichnis
- Formatierung nach Richtlinien
- Präsentation (Kolloquium)
- 7 Tage bis 12 h Express

Wissenschaftliche Arbeit schreiben Tipps
Eine akademische Arbeit verfolgt immer das Ziel, ein Thema bzw. neue Ergebnisse mithilfe von wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden zu erschaffen. Es gilt, dass sich auch fachfremde Leser mithilfe des theoretischen Teils der wissenschaftlichen Arbeit in das Thema einarbeiten können. Die Ergebnisse, die durch das wissenschaftliche Arbeit schreiben entstanden sind, sollen zudem reproduzierbar sein.
Um diese Ziele zu erreichen, wird Wissen aus Fachliteratur zusammengetragen, systematisch und logisch dargestellt sowie Teile davon diskutiert. Dadurch soll es gelingen, dass bearbeitende Thema und geschaffene Wissen anderen Forschern verständlich, zugänglich zu machen.
1a-Studi-Tipp: Eine große Motivation für das wissenschaftliche Arbeit schreiben ist es immer, dass du durch das Ergebnis einen Mehrwert zum Forschungsbereich zutragen kannst.
Tipps für das gute wissenschaftliche Arbeiten
Vor allem für die Formulierungen in einer wissenschaftlichen Arbeit sind zahlreiche Prinzipien zu beachten:
Gliederung und roter Faden
Beginne das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit nie, ohne vorher die Gliederung und stichpunktartig Inhalte festgelegt zu haben. Das Exposé ist hierbei ein geeignetes Mittel, um den roten Faden für deine Hausarbeit, Bachelorarbeit oder Masterarbeit zu planen.
Eindeutige Fragestellung/Ziel
Das Ziel ist es, eine Fragestellung zu beantworten oder ein in der Einleitung festgelegte Zielsetzung zu erreichen. Ein häufiger Fehler ist es, dass zu viele Fragen oder mehrere Zielsetzungen festgelegt werden. Dadurch wird es fast unmöglich, einen sauberen roten Faden der wissenschaftlichen Arbeit zu verfolgen.
Präzise Formulierungen
Das wissenschaftliche Schreiben ist eine eigene Fachdisziplin. Vor allem, wenn mit zahlreichen Literaturquellen gearbeitet wird, ist es wichtig, präzise Sätze zu formulieren. Diese sollten dabei immer zu Überschrift passen und der Zielsetzung der Arbeit entsprechend. Vermeide eigene Meinungen und überflüssige Details sowie unnötige Umschreibungen.
1a-Studi-Tipp: Mit den professionellen 1a-Studi Korrekturdiensten werden alle Fehler aus deiner Arbeit entfernt und die Sätze präzise korrigiert.
Meinungsvielfalt der Fachliteratur
Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet, ein Thema aus mehreren Perspektiven zu betrachten und zu untersuchen. Achte daher bei der Literaturauswahl deiner wissenschaftlichen Arbeit darauf, dass dieser aktuell und vielfältig ist. Pro Seite solltest du daher ca. 2 – 3 Quellen verarbeiten.
Roter-Faden & Inhalt
1a-Studi Experten prüfen den roten Faden und Inhalt deiner wissenschaftlichen Arbeit.
- 184+ Kriterien der Wissenschaft
- Experten-Feedback
- Anleitungen und Hilfe
- Schwächen und Fehler beheben
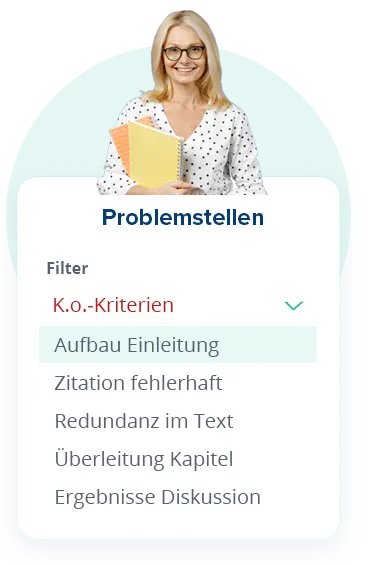
Vollständige Zitation
Die richtige Zitation in einer wissenschaftlichen Arbeit ist essenziell. Neben der lückenlosen und nach der Richtlinie der Hochschule entsprechenden Zitation (wichtig für die Benotung) führt die falsche oder unzureichende Zitation zu einem Plagiat.
Intersubjektive Nachprüfbarkeit
Eine gute wissenschaftliche Arbeit folgt einer Methodik . Diese beschreibt, mit welchem Forschungsverfahren die Arbeit bearbeitet und somit die Ergebnisse geschaffen werden.
Daher sollte die Methodik unbedingt ausführlich behandelt und beschrieben werden. Dies gilt insbesondere für empirische Arbeiten.
Kritische Auseinandersetzung
Die Ergebnisse in deiner wissenschaftlichen Arbeit sind sehr oft nicht allgemeingültig, da diese nur einen umfassen. Daher gilt es für eine wissenschaftliche Arbeit, die Ergebnisse zu diskutieren und mögliche Problemstellen und Limitationen aufzudecken.
Schreiben lassenWissenschaftliche Arbeit schreiben lassen
Eine wissenschaftliche Arbeit schreiben lassen, ist keine gute Idee. Beim sogenannten Ghostwriting wird eine Person beauftragt, eine Arbeit für einen Studenten zu schreiben. Die gekauften Arbeiten sind selten frei von Plagiaten.
Wie das Ghostwriting funktioniert und welche Gefahren und Risiken es gibt, kannst du im Detail in der 1a-Studi Wissensdatenbank nachlesen.
Aufbau und GliederungArbeit wissenschaftlich schreiben
Eine Arbeit wissenschaftlich zu schreiben, bedeutet immer, eine Struktur, Gliederung und einen roten Faden einzuhalten.
Eine gute wissenschaftliche Thesis basiert auf der Struktur:
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Praktischer Teil
- Ergebnisse und Diskussion
- Fazit
Wenn du deine erste lange wissenschaftliche Arbeiten schreibst, dann kann es hilfreich sein, wenn du dich an bestehenden Beispielen orientierst. Achte jedoch darauf, dass du dich nur inspirieren lässt und vermeide unbedingt, Texte aus den Beispielen zu kopieren. Es droht ansonsten garantiert ein Plagiat.
Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, ist das Exposé eine beste Möglichkeit, um dich auf das Schreiben der Arbeit vorzubereiten. Gedanklich ist es sehr hilfreich, wenn du dir vorab bereits vorstellst, welche Ergebnisse du durch deine wissenschaftliche Arbeit generieren möchtest.
Wichtig ist, dass alle Formulierungen in deiner wissenschaftlichen Arbeit stets darauf abzielen, die in der Einleitung festgelegte Zielsetzung/Fragestellung zu beantworten.
Unnötige Formulierungen oder Ausschweifungen sollten vermieden werden. Das wissenschaftliche Arbeiten sollte stets präzise sein, das bedeutet, weniger ist mehr.
1a-Studi-Tipp: In der 1a-Studi Wissensdatenbank findest du Formulierungshilfen, Beispiele und Expertenempfehlungen für das Schreiben von Bachelorarbeit , Masterarbeit , Hausarbeit , Seminararbeit , Facharbeit , Praktikumsbericht.
Wenn du weitere individuelle Fragen zum Schreiben deiner Arbeit hast, dann kannst du deine Fragen gerne in der 1a-Studi Expertengruppe stellen. Hier tauschen sich Studierende über das Studium und wissenschaftliche Schreiben aus. Du kommst garantiert von der Community eine Antwort, aber spätestens durch die Moderation eines Experten aus dem Team von 1a-Studi.
Häufige Fragen & AntwortenDu hast noch weitere Fragen zu deiner wissenschaftlichen Arbeit, die du nicht in diesem Artikel beantwortet bekommen hast? Dann recherchiere weiter in der Wissensdatenbank für wissenschaftliches Arbeiten hier bei 1a-Studi.


